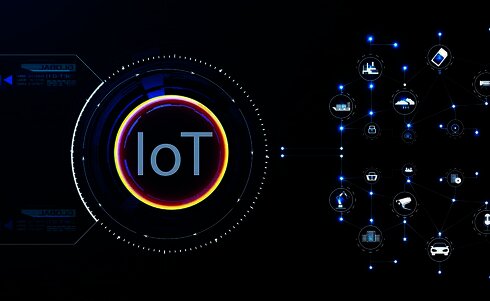Datensouveränität, Digitale Souveränität und die Zeitwende der Datenströme
Der Ruf nach Souveränität im Digitalen ist unvermindert aktuell
Wer das S-Wort nicht mehr hören kann – ja, ich kann es nachvollziehen. „Datensouveränität“, „Digitale Souveränität“, „Plattformsouveränität“, „souveräne“ Infrastrukturen?
Seit Monaten wirkt die Diskussion verworren, schon rein begrifflich, und die Rede von der Souveränität nutzt sich ab. Das ist schade, denn eigentlich geht es um Wichtiges, und auch um Herausforderungen, die sich überlagern.
Die Unterschiede zwischen den Begriffen lassen sich freilegen. Im Bereich von Medizindaten, aber auch überhaupt hinsichtlich personenbezogener Daten mehr „Datensouveränität“ zu wagen, hat unter anderem 2017 der Deutsche Ethikrat angeregt.
Nicht immer möchten Menschen unter dem Deckel des Datenschutzes bleiben, es kann auch Motive für eine aktive Hergabe eigener Daten geben. Informationelle Selbstbestimmung meint also durchaus, der Mensch als Datensubjekt ist „souverän“. Datenschutz sei kein Selbstzweck, so der Ethikrat. Der Anstoß hat zu lebhaften Debatten in Datenschutzkreisen geführt.
„Digitale Souveränität“ hat die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Antrittsrede 2020 auf die Agenda gesetzt. Europäische Unternehmen, aber auch europäische Bürgerinnen und Bürger dürfen sich nicht von Datendiensten aus den USA und China abhängig machen.
Schon vorher machten Expertengremien und auch die damalige Kanzlerin Merkel dies dringlich: Die globale Plattformökonomie ist asymmetrisch. Deutschland und Europa benötigen Unabhängigkeit im digitalen Raum.
Der Begriff „Infrastruktursouveränität“ versucht wiederum, die digitale Souveränität zu konkretisieren: Es geht nicht allein um Software oder um Marktbalancen, sondern tatsächlich um soziotechnische Herausforderungen (vgl. Musiani, OVE-Newsletter vom 14.6.2022), also Menschen und Kompetenzen, dazu um Hardware und um Sicherheitsfragen.
Ich habe „Datensouveränität“ und „Digitale Souveränität“ mit Scheinwerfern verglichen, deren Lichtkegel sich überschneiden: Betrifft der erste Begriff die individuelle und die Unternehmensebene, überall dort wo Datenhaltung und Datenschutz im Spiel sind, so leuchtet der zweite Begriff Machtfragen auf der zwischenstaatlichen Ebene an: Hier stehen ganze Märkte und staatliche Vormachtstellungen im Vordergrund.
Es geht um den Rückbau der Abhängigkeit von Anbietern, welche uns Preise diktieren können, über die Ausgestaltung von Software und von digitalen Bauteilen entscheiden und in großem Stil Datenspuren von Bürgern und Unternehmen auslesen und analysieren.
Beide Anliegen – ein hinreichend geschmeidiges Datenschutzverständnis wie auch die digitale Unabhängigkeit – sind nach wie vor hochaktuell.
Putin, China und bald wieder Wahlen in den USA: Durch die veränderte geopolitische Lage scheint nun aus der „Infrastruktursouveränität“ ein dritter, greller Scheinwerferbegriff zu werden.
Digitalität ist bislang mehr oder weniger naiv für eine friedliche Welt konzipiert gewesen. Global fließen Daten ungehindert, und Grenzen fallen weg: Gerade das sollte ja Mehrwerte schaffen. Stand heute war einiges an dieser Vorstellung naiv. Nicht überall auf dem Globus ist die Welt so friedlich wie in Kalifornien, wo diverse Konzernzentralen stehen.
So muss man inzwischen wohl von einer Zeitenwende der Datenströme sprechen: Auch der digitale Raum ist kein „Raum“, sondern ein komplexes infrastrukturelles Gefüge, das Grenzen besitzt und sogar auch Grenzen braucht.
Digitale Selbstbestimmung mutiert von daher zu einer Sicherheitsfrage – und zwar über die bloße Datensicherheit hinaus. Man kann das bedauern. Aber schönreden sollten wir uns die Lage nicht.
Was schon komplex war, wird noch komplexer: Datensouveränität ist eine Baustelle, digitale Souveränität erfordert Kreativität sowie wirtschafts- und innovationspolitisch einen langen Atem. Zusätzlich schlägt aber auch noch die Stunde der Infrastruktursouveränität.

Buchtipp
Steffen Augsberg, Petra Gehring (Hrsg.): Datensouveränität: Positionen zur Debatte. Frankfurt am Main, New York: Campus-Verlag 2022.
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/philosophie/datensouveraenitaet-17349.html

Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI)